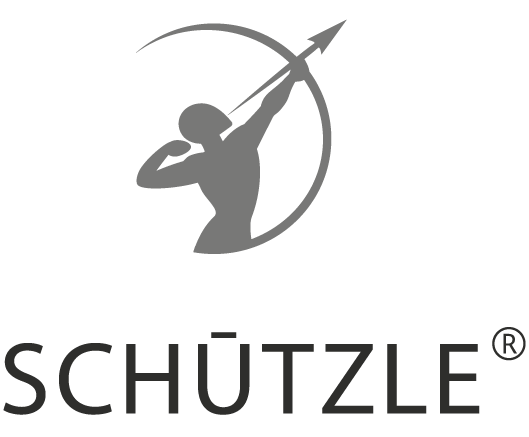Mit einem Urteil vom 28.01.2025 entschied der BGH, dass ein Schadensersatzanspruch nach Art. 82 DSGVO nicht allein wegen einer unerlaubten Werbe-E-Mail besteht. Damit ein entsprechender Anspruch entsteht, müssen weitere Voraussetzungen vorliegen, wie ein tatsächlich entstandener Schaden.
Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die klagende Partei ist Verbraucher und hat bei dem beklagten Unternehmen eingekauft. Einige Wochen später meldete sich die Beklagte per E-Mail bei dem Kläger und warb mit seinen weiteren Angeboten und Service. Der Kläger versandte noch am gleichen Tag eine E-Mail an die Beklagte, mit der er der „Verarbeitung oder Nutzung“ seiner Daten „für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung auf jeglichem Kommunikationsweg“ widersprach. Daneben verlangte der Kläger die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung und „Schmerzensgeld gem. Art. 82 DSGVO“ in Höhe von EUR 500,-.
Der BGH lehnte den Anspruch auf Schadensersatz ab. Dies begründete er damit, dass der Kläger keinen materiellen Schaden gelten machte und auch kein immaterieller Schaden feststellbar sei.
Das bloße Vorliegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften der DSGVO sei bereits nach Sicht des EuGH nicht ausreichend für die Begründung eines Schadensersatzanspruches nach Art. 82 DSGVO. Vielmehr sei der Eintritt eines Schadens durch diesen Verstoß gegen die DSGVO erforderlich.
Weiter wird durch das Gericht zum immateriellen Schaden ausgeführt, dass dieser keine Bagatellgrenze erreichen muss; eine Erheblichkeitsschwelle hinsichtlich der Schwere eines (immateriellen) Schadens dürfe es nicht geben.
Dies bedeute laut Gericht jedoch nicht, dass die betroffene Person von einem Nachweis des immateriellen Schadens befreit sei.
In dem vorliegenden Fall stellte das Gericht fest, dass der Kläger einen solchen Schaden nicht hinreichend darlegen konnte. Zwar machte der Kläger den Eindruck des Kontrollverlusts über seine Daten geltend, konnte jedoch, nach Ansicht des Gerichts, nicht ausreichend nachweisen, dass er durch diesen Kontrollverlust auch einen Schaden erlitten habe. Auch einen tatsächlich vorliegenden Kontrollverlust der Daten des Klägers verneinte das Gericht. Diese könne in dem vorliegenden Fall nur dann vorliegen, wenn mit Versand der Werbe-E-Mail die Daten des Klägers zugleich Dritten zugänglich gemacht worden wären.
Quelle: BGH, Urt. v. 28.01.2025, Az. VI ZR 109/23