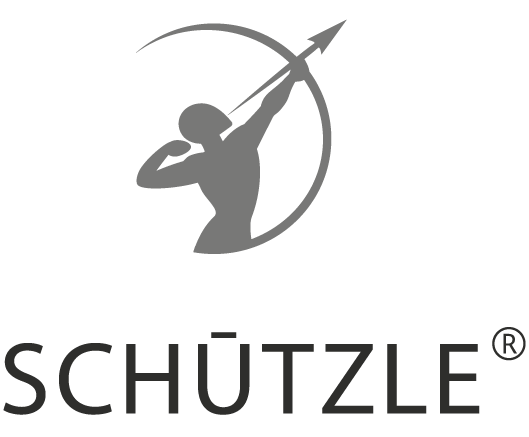Das Landgericht Bonn hat mit Urteil vom 3. Juni 2025 über die Zulässigkeit der Datenübertragung in die USA durch einen US-amerikanischen Betreiber eines sozialen Netzwerks entschieden.
Der Kläger machte Schadensersatzansprüche für behauptete Datenschutzverstöße geltend, wie die unzulässige Übertragung der Daten in die USA und eine verweigerte Auskunft, ebenso verlangte er Auskunft u.a. darüber, wie außereuropäische Nachrichtendienste ggfs. Zugang zu seinen Daten durch die Nutzung des sozialen Netzwerks hatten.
Das Gericht lehnte die Klage vollumfassend ab und begründet dies unter anderem damit, dass die Übertragung in die USA rechtmäßig sei, da bei der Nutzung eines internationalen sozialen Netzwerks eine solche Übertragung notwendig sei. Die Datenübertragung in die USA sei seit dem Inkrafttreten des Angemessenheitsbeschlusses zwischen der EU und der USA (Data Privacy Framework) zulässig. Im Übrigen sei die Datenübertragung in die USA auch vor dem Inkrafttreten des Angemessenheitsbeschlusses bereits zulässig nach Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO gewesen, da die Datenübertragung für die Erfüllung des Vertrags (= Nutzung des sozialen Netzwerks) notwendig sei. Dem geltend gemachten Auskunftsanspruch darüber, ob und welche Nachrichtendienste in den USA Zugriff auf die Daten des Klägers hätten haben können, muss der beklagte Betreiber des sozialen Netzwerks laut Gericht auch nicht nachkommen. Grund hierfür ist laut dem Gericht die unauflösbare Kollision der Pflicht nach deutschem Gesetz, die Auskunft zu erteilen und der entgegengesetzten Pflicht nach US-Recht, die Auskunft zu verweigern.
Bemerkenswert ist das Urteil aber gerade deswegen, da das Gericht deutliche Worte – und Kritik – an der rechtlichen und politischen Lage in den USA findet.
Wörtlich heißt es in dem Urteil unter anderem:
„Es ist dabei seit vielen Jahren – spätestens durch die Enthüllungen von Edward Snowden im Jahr 2013, Deutschland betreffend insbesondere auch durch die nach deutschem Recht offenkundig rechtswidrige Ausspähung des Smartphones der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel durch amerikanische Geheimdienste – allgemein in Deutschland bekannt, dass in den USA im Vergleich zur EU ein nicht vorhandenes bis nur eingeschränktes Datenschutzrecht betreffend den einzelnen Bürger gilt […], was übrigens die Aussagen des aktuellen Vizepräsidenten der USA J.D. Vance im Februar 2025 in München, wonach angeblich die Freiheitsrechte der Bürger in Deutschland weniger geschützt seien als in den USA […] der Lächerlichkeit preis gibt. Tatsächlich haben die USA die Datenschutzrechte ihrer (und erst recht ausländischer) Bürger schon lange "auf dem Altar der (vermeintlichen) Sicherheit geopfert" - anders als Deutschland und die weiteren EU-Staaten […].“
Weiter heißt es auch:
„Gleichwohl hat der US-amerikanische Staat seitdem wenig bis gar nichts dazu gelernt, was angesichts einer inzwischen offen rechtsextremistisch-populistischen Regierung in den USA unter ihrem aktuellen Präsidenten Donald Trump, die inzwischen sogar jahrzehntelange Bündniszusagen in Frage stellt, von denen auch die USA jahrzehntelang politisch und auch wirtschaftlich massiv profitiert haben, auch wenn sie das nicht (mehr) zugeben wollen (oder verstehen können), nicht überraschen muss. Rechtsextremisten waren gerichtsbekannt immer schon die größten Feinde individueller Freiheit (der "Anderen" bzw. Andersdenkenden), während sie sich zugleich ständig – die Lüge beharrlich wiederholend – als ihre angeblich größten Verteidiger gerieren, um das eigene (Wahl-)Volk irrezuführen – was leider häufig funktioniert, insbesondere inzwischen über „soziale“ Medien, wie die letzten Jahre gezeigt haben. Daneben sind Rechtsextremisten in aller Regel die korrupteste Sorte von Politikern, weil die ideologische Grundbasis des Rechtsextremismus unvernünftig übersteigerter (nationaler und individueller) Egoismus ist.“
Und:
„All dies ändert indes nichts daran, dass die USA – noch – ein verbündeter Staat Deutschlands sind und trotz der deutlich anti-demokatisch, anti-rechtsstaatlich, autokratisch bis faschistischen Tendenzen der aktuellen US-Regierung und trotz der erheblichen Defizite beim Schutz der Freiheits-, insbesondere Datenschutzrechte – noch – als rechtsstaatliche Demokratie anzusehen sind und damit einem US-amerikanischen Unternehmen, welches in Europa grundsätzlich legale Geschäfte mit Bürgern betreibt, zugestanden werden muss, sich an die Gesetze der USA zu halten und dies in Deutschland – im Einzelfall – zu dulden ist, auch wenn hierdurch Datenschutzrechte der Bürger in einem gewissen Maße eingeschränkt werden.“
Abschließend stellt das Gericht sodann noch in den Raum, dass die Ausführungen des Gerichts „durchaus die Rechtmäßigkeit des Angemessenheitsbeschlusses […] in Frage stellen könnten“, das Gericht habe dies aber nach Art. 45 Abs. 1 DSGVO nicht zu überprüfen.
Diesem Urteil dürfte einiges an Bedeutung zuzusprechen sein. So zeigt es zwar, dass eine Datenübertragung personenbezogener Daten aus der EU in die USA nach dem bestehenden Angemessenheitsbeschlusses zulässig sein kann. Deutlich wird jedoch auch, dass es nach wie vor ein grundlegend unterschiedliches Verständnis des Datenschutzes in der EU und den USA gibt – was sich wiederum auf die jeweilige Gesetzeslage auswirkt. Wie sich diese rechtliche und politische Lage noch auf die Wirksamkeit des Angemessenheitsbeschlusses und damit auf die Verarbeitung von EU-Daten in den USA auswirkt, bleibt abzuwarten.
Quelle: LG Bonn, Urt. v. 03.06.2025, Az. 13 O 156/24
https://nrwe.justiz.nrw.de/lgs/bonn/lg_bonn/j2025/13_O_156_24_Urteil_20250603.html